Beschluss der BAG Wissenschaft, Hochschule, Technologie zur „Weiterentwicklung des Kapazitätsrecht“ (Beschluss im Umlaufverfahren, Version vom April 2010)
Problemlage
Das seit Anfang der Siebzigerjahre bestehende Kapazitätsrecht ist in den vergangenen Jahren zunehmend in die Kritik geraten. Es gilt als zu schwerfällig, oftmals ungerecht, und wenig flexibel gegenüber den aktuellen Herausforderungen an die Profilierung einzelner Studiengänge und in Bezug auf die Umsetzung der mehrphasigen Studiengänge. Viele dieser Kritikpunkte sind im Zusammenhang mit anderen Auseinandersetzungen an den Hochschulen zu sehen: Im Rahmen der Umstellung auf Bachelor und Master wurde von Hochschulen wie Politik eine stärkere Differenzierung gewünscht, und Diskussionen über Profile mit deutlich unterschiedlichen Ausstattungen geführt, um diese Differenzierung voranzutreiben bzw. überhaupt zuzulassen. Auch wir können uns als Bündnis 90/Die Grünen ein gewisses Maß an Differenzierung vorstellen (zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hierfür s.u.). Mit dem bestehenden Kapazitätsrecht ist eine solche Differenzierung bislang (nahezu) nicht möglich. An dieser Differenzierungsdebatte hängt auch eine – von Grünen wiederum nicht befürwortete – Forderung nach einseitiger Auswahl von Studierenden und ggfs. dem Freilassen von Studienplätzen. Dem steht zudem die bestehende Rechtsprechung der Verfassungsgerichte gegenüber, die aus der Freiheit der Berufswahl in Artikel 12 Grundgesetz enge Grenzen ableitet, wenn es darum geht, den Zugang zum Studium zu beschränken. In Folge dessen wurde das geltende Kapazitätsrecht entwickelt. Doch auch aus bündnisgrüner Sicht gilt: Wir wollen und müssen das Kapazitätsrecht weiterentwickeln, es an das Bachelor/ Master-System anpassen und die bessere Berücksichtigung von neuen Lehr- und Lernformen, Modellversuchen in der Lehre und anderen innovativen Studiengangsmodellen ermöglichen.
Eckpunkte für ein neues Kapazitätsrecht
Grundlage des jetzigen Kapazitätsrechts sind die Auseinandersetzungen – auch vor den Verfassungsgerichten – um die Verteilung von zu geringen Studienplatzkapazitäten vor mehr als dreißig Jahren. Die Studienplatzsituation hat sich bundesweit seither wenig verbessert. Mit den doppelten Abiturjahrgängen, aber auch dem generellen Ziel einer Steigerung der AkademikerInnenquote kommen zudem weitere Herausforderungen auf die Hochschulen zu – umso mehr für alle, die den Anspruch haben, Zugangsgerechtigkeit herzustellen. So lange strukturelle Unterfinanzierung und Einsparzwänge dazu führen, dass auch in den nächsten Jahren eine ungenügende Anzahl von Studienplätzen für alle StudienbewerberInnen vorhanden sein wird, muss dafür gesorgt werden, dass
- vorhandene Studienkapazitäten tatsächlich ausgeschöpft werden,
- die Ermittlung dieser Kapazitäten transparent, nachvollziehbar und juristisch überprüfbar ist,
- vergleichbare Verfahren angewandt werden, die hochschul- und hochschultypneutral sein müssen,
- die Qualität der Lehre gewährleistet ist, also keine ‚Dumping-Ausstattung‘ zugelassen wird, mit der eine Studium faktisch nicht organisierbar ist, was auch bedeutet, dass anzusetzende Gruppengrößen der Art und dem Inhalt der Lehrveranstaltung gerecht werden müssen,
- der tatsächlich anfallende Lehraufwand abgebildet wird, ohne zum allzu kreativen Umgang mit Ermäßigungstatbeständen im Bezug auf die Lehrverpflichtung einzuladen,
- Profilierung einzelner Studiengänge und Hochschulen möglich ist, aber in Abwägung mit dem vorrangigen Ziel, die Nachfrage angemessen zu befriedigen und auch nicht, wo dies unbillig zu Lasten anderer Hochschulen und Studiengänge geht.
Dies ist derzeit eine politische Aufgabe vor allem für die Landesparlamente und die gemeinsame Wissenschaftskommission (GWK). Der Bundesgesetzgeber könnte hier einen Rahmen setzen. Im Sinne der bundesweiten Vergleichbarkeit könnte dies ein sinnvoller Schritt sein. Aus bündnisgrüner Perspektive besteht kein Interesse daran, durch schlecht konstruierte Neuregelungen eine neue verfassungsrechtliche Klärung zu provozieren – die Grundlage des jetzigen Kapazitätsrechtes, die vor allem die Pflicht zur Ausschöpfung der Kapazitäten und zur Gleichbehandlung der BewerberInnen und Hochschulen betont, ist für uns weiterhin gegeben.
Das Kapazitätsrecht soll vor allem dazu dienen, aus den vorhandenen Ressourcen, d.h. Stellen und Mitteln an den Hochschulen, die verfügbaren Studienplätze auf nachvollziehbare Weise zu ermitteln. Es sollte nicht als Schauplatz für andere hochschulpolitische Debatten genutzt und darf nicht mit weiteren Aufgaben überfrachtet werden. Z. B. gehört die Festlegung von Profilbereichen der Hochschulen in Entwicklungspläne oder Zielvereinbarungen, an denen die zuständigen Gremien beteiligt werden müssen. Auch darf das Kapazitätsrecht nicht dazu missbraucht werden, unzureichende finanzielle Mittel zu verschleiern, z.B. eine nicht erfolgte Finanzierung der Mehrbedarfe durch Umstellung auf das Bachelor-/Master-System.
Qualitative Differenzierungen und Profilierungen von Studienangeboten müssen im Rahmen der den Hochschulen zur Verfügung stehenden Mittel möglich sein. Dieses darf aber nicht zur Absenkung des Niveaus anderer Studiengänge führen.
Bewertung der zur Zeit diskutierten Modelle
Für Bündnis 90/Die Grünen ist die völlige Freigabe der Kapazitätsermittlung keine Option. Jenseits der kompletten Abschaffung sind aktuell vor allem zwei Modelle in der politischen Diskussion, das so genannte Vereinbarungsmodell und das so genannte Bandbreitenmodell.
Beim Vereinbarungsmodell wird frei zwischen Hochschule und Land verhandelt, wie viele Studienplätze in welchem Fächerbereich für welche finanzielle Zuweisung einzurichten bzw. vorzuhalten sind. Der Vorteil dieses Modells ist, dass die Festlegung sehr genau auf die jeweilige Profilierung und konkrete Ausgestaltung der einzelnen Studiengänge eingehen kann. Nachteilig ist, dass die festzusetzende Zulassungszahl vor allem vom Verhandlungsgeschick und den Prioritäten der Beteiligten abhängt. Ungerechtigkeiten zwischen Fächern und Hochschulen sind bei begrenzten finanziellen Mitteln quasi vorprogrammiert. Eine Festsetzung der Studienplatzzahl nach reiner Aushandlung, ohne dass Kriterien wie Lehrverpflichtung, Personalkapazität, Studienordnungen und deren Vorschriften, vorhandene Laborplätze o. ä. eingehen, ist zudem nicht durch Dritte überprüfbar oder vergleichbar. Das Recht der StudienbewerberInnen, dass ein Maximum an Studienplätzen geschaffen wird, wäre somit nur noch auf dem Papier existent, aber nicht mehr durchsetzbar. Deshalb gibt es gegen ein Vereinbarungsmodell erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken.
Beim Bandbreitenmodell erfolgt ähnlich dem derzeit gültigen Verfahren eine Festsetzung eines Normwertes an Ausstattung – allerdings als Bandbreite. Der Hochschule steht es also frei, ob sie viel Betreuungskapazität für einen Studiengang vorsieht, oder aber zum Beispiel nur das Minimum dessen, was zur Durchführung des Studiums unbedingt notwendig angese-hen wird. Die Hochschule kann also innerhalb des eigenen Fächerspektrums Schwerpunkte setzen. Allerdings bleibt das so ermittelte Studienplatzangebot auf bisherige Weise gerichtlich überprüfbar und es stellt sich die Frage der unterschiedlichen Behandlung der Studiengänge in den Hochschulen: Wenn ein Studium auch mit weniger Personaleinsatz realisierbar wäre, warum soll Hochschule A dann mit derselben Personalausstattung weniger Studierende aufnehmen müssen als Hochschule B? Dies bedeutet für die Hochschulen weiterhin, im Klagefall darlegen zu müssen, warum sie sich nicht am niedrigsten Wert der Bandbreite orientiert. Allerdings zeigt die Erfahrung mit bisher praktizierten, faktisch existenten Bandbreitenmodellen hier kein großes Problem für die Hochschulen.
Schlussfolgerungen
Die BAG Wissenschaft, Hochschule, Technologie hält eine Weiterentwicklung der geltenden KapVO für notwendig, da diese den gestuften Abschlüssen und diversifizierten Studiengän-gen nur unzureichend gerecht wird. Gleichzeitig halten wir den Zeitpunkt für das Experiment eines kompletten Systemwechsels mit unkalkulierbaren Risiken auf Grund der demographischen und hochschulpolitischen Herausforderung auf dem Weg in die Wissensgesellschaft für denkbar ungeeignet. Zukünftig muss zudem geklärt werden, wie – beim Ausbau von derartigen Studienangeboten – mit der entstehenden Lehrverpflichtung im Bereich von DoktorandInnenprogrammen umgegangen wird. Wir treten daher insgesamt für eine zielgerichtete Reform der geltenden Regelungen mit Augenmaß ein.
Das Vereinbarungsmodell vermischt planerische Entscheidungen, z.B. die Festlegung von Profilbereichen von Hochschulen, die in Strukturentwicklungspläne oder Zielvereinbarungen gehört, mit der Ermittlung von Kapazitäten nach klaren Kriterien. Außerdem besteht die Gefahr, dass als Ergebnis von Verhandlungen einzelne Hochschulen ihre Kapazitäten nicht ausschöpfen, während andere mehr Studierende bei nicht ausreichenden Ressourcen aufnehmen. Daher lehnen wir ein reines Vereinbarungsmodell ab. Denkbar wäre allenfalls ein Modell, das die Studienplatzkapazität hauptsächlich an die vorhandenen Ressourcen knüpft und Vereinbarungsanteile nur bei spezifischen Besonderheiten einzelner Studiengänge ermöglicht.
Das Bandbreitenmodell eröffnet Spielräume um Profilbildungen zu berücksichtigen, allerdings bleibt die Ermittlung der Studienplatzkapazitäten an Regeln und Vorgaben gebunden. Die Entscheidungen über Schwerpunktsetzungen sollten fachnah erfolgen. Diese müssen zukünftig klarer und transparenter gestaltet werden, um die Nachvollziehbarkeit gegenüber dem heute gültigen Kapazitätsrecht zu erhöhen. Neue Lehr- und Lernformen und Spezifika des Bachelor-/Master-Systems müssen besser abgebildet werden können. Zudem müssen Veränderungen in der Personalausstattung an sich berücksichtigt werden – eine Zulassungszahl muss sich auch wieder senken lassen, ohne den Studiengang komplett abschaffen zu müssen. Die Nutzung der Bandbreiten muss begründet werden, um deren bloße Ausnutzung zur „Niveaupflege“ oder zur Absenkung eines Qualitätsniveaus zu verhindern. Bei der Festsetzung der Bandbreiten muss gewährleistet sein, dass die Curricularnormwerte (CNW) auch den tatsächlichen Lehraufwand in den betreffenden Studiengängen widerspiegeln. Hierbei ist Rechtssicherheit für die Hochschulen zu schaffen, so dass im Klagefall nicht automatisch der Mindestwert der Bandbreite angeordnet wird.
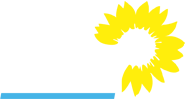
Verwandte Artikel
Beschluss: „Faire Arbeitsverträge in der Wissenschaft!“
Seit 2007 regelt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) die befristete Anstellung von Wissenschaftler*innen. Als Sonderarbeitsrecht ermöglicht es prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Schon die Novelle im Jahr 2016 hatte das Ziel, den…
Weiterlesen »
#WeStandWithUkraine
Nur Frieden und Demokratie ermöglichen Freiheit – auch Wissenschaftsfreiheit in gesellschaftlicher Verantwortung.
Weiterlesen »
Rahmenstruktur der Beschäftigung in der Wissenschaft
Beschäftigung in und mit Wissenschaft ist geprägt durch ein besonderes Arbeitsumfeld. Das liegt begründet einerseits in der großen Freiheit bei der Wahl der Ziele, Zwecke und Mittel der Tätigkeit, die…
Weiterlesen »