Beschluss der Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschafts-, Hochschul- und Technologiepolitik von Bündnis 90 / Die Grünen vom 28.02.2004
(Kurzfassung)
1.
Die BAG WHT hält an der Gebührenfreiheit des Studiums bis zum Diplom-, Magister- oder Mastergrad sowie der Promotionsphase fest. Sie spricht sich deutlich gegen die Einführung von Studiengebühren, auch solchen nachgelagerter Art, aus. Sie stellt in diesem Zusammenhang fest:
• Die seit Anfang dieses Jahres geführte Innovationsdebatte greift in Fragen der Hochschulreform zu kurz: Die größten Herausforderungen an das Hochschulsystem, etwa die europäische und internationale Dimension, und die großen Strukturprobleme der Hochschulen, wie unzureichende Autonomie, schlechte Studienbedingungen, altmodische Lehr- und Lernformen, falsche Personalstrukturen und wenig attraktive Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs, kommen zu wenig zur Sprache. Hier besteht dringender Handlungsbedarf auf Bundes- und Landesebene, aber auch in den Hochschulen selbst.
• Die Innovationsdebatte hat bisher auch nicht zu einer fundierteren Diskussion über die Hochschulfinanzierung geführt. Es wird vielfach der falsche Eindruck erweckt, als sei die Einführung von Studiengebühren die wichtigste Innovation im Bildungswesen, mit der die meisten Probleme auf einen Schlag gelöst würden. Dies würde jedoch kaum etwas an den strukturellen Problemen des bundesdeutschen Bildungssystems und insbesondere der Hochschulen ändern, sondern weitere Probleme würden hinzukommen. • Hochschulen und andere Bildungsbereiche benötigen auch eine bessere Finanzierung.
Statt den derzeit laufenden Steuersenkungswettbewerb immer weiter fortzuführen, der zu weiteren Kürzungen in allen Bildungsbereichen führen wird, sollten Kitas, Schulen und Hochschulen endlich als ein Innovationsfeld erkannt werden, in das es sich zu investieren lohnt. Wege dazu wären zum Beispiel ein „Bildungscent“ als Teil der Einkommenssteuer, die zweckgebundene Verwendung von Einnahmen aus dem Verkauf der Goldreserven der Bundesbank oder aus der anstehenden Reform der Erbschaftssteuer und die Abschaffung ökologisch schädlicher Subventionen. Zusätzlich sollte eine Kultur gefördert werden, in der Stiftungs- und Mäzenatentum Bildung in verstärktem Maße fördert.
• Eine Eigenbeteiligung der Studierenden an den Ausgaben für die Hochschulen (Studiengebühren), auch wenn sie nachgelagert wäre, würde zwar dem Staat eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnen, aber absehbar weder eine nachhaltige Verbesserung der Lage der Hochschulen in Deutschland mit sich bringen, noch erscheinen die Negativeffekte einer solchen Gebührenerhebung oder einer Spezialabgabe für Studierende und/oder HochschulabsolventInnen tragbar.
• Für die Einführung von Studiengebühren sprechen weder zwingende Gerechtigkeitsargumente noch eindeutige ökonomische Erkenntnisse, sondern dies bleibt eine politisch zu entscheidende Frage. Eine genauere Betrachtung der Belastungen und Gewinne einzelner Gruppen zeigt, dass eine Abkehr von der Steuerfinanzierung der Hochschulen hin zu einer Abgabenfinanzierung im Gegenteil sogar bestehende soziale Ungerechtigkeiten vergrößern würde.
2.
Die BAG fordert eine gemeinsame Kraftanstrengung aller gesellschaftlichen Gruppen für ein besseres Bildungssystem. Ziel muss sein, nicht nur deutlich mehr staatliche Mittel für den Bereich der Bildung – von der vorschulischen bis zum lebenslangen Lernen und der beruflichen Weiterbildung – zu mobilisieren, sondern auch, die gravierenden Strukturprobleme anzugehen, die gerade die bundesdeutschen Hochschulen plagen.
3.
Ein wichtiger Reformschritt ist auch die Einführung eines elternunabhängigen Studien- und Ausbildungsfinanzierungssystems als Weiterentwicklung des BaföG. Wir bitten die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, zu prüfen, inwieweit bei einer Einführung von BAFF heute Anpassungen notwendig wären, und wie der Anschubfinanzierungsbedarf für einen Systemwechsel aussieht. Zu prüfen ist außerdem, wie sich das BAFF-Modell mit den Anforderungen und der Finanzierung lebenslangen Lernens – etwa durch nicht-konsekutive Master-Studiengänge – vereinbaren lässt. Die höhere Eigenbeteiligung der Studierenden beim BAFF im Vergleich zum BaföG muss bei jeder Debatte über Studiengebühren berücksichtigt werden.
4.
Zur Frage der Einführung von Studienkonten- oder Gutscheinmodellen zur nachfrageorientierten Finanzierung der Hochschulen gibt es keine einheitliche Position in der BAG. Auch nach wiederholter und intensiver Diskussion werden solche Modelle von einem Teil der Delegierten unter bestimmten Bedingungen grundsätzlich befürwortet, von anderen Delegierten weiterhin abgelehnt. Daher sieht sich die BAG auch nicht in der Lage, eine Position zu befürworten, die die Landesverbände und Landtagsfraktionen auffordert, für die Einführung solcher Modelle einzutreten.
(Langfassung)
I. Mehr Innovation und Gerechtigkeit durch Studiengebühren?
Über die Frage, ob und in welcher Weise die Studierenden an den Kosten ihrer Hochschulausbildung beteiligt werden sollen, wird immer wieder kontrovers diskutiert. Die BAG WHT hat sich zuletzt in einem Beschluss vom 3. Juni 2000 gegen Studiengebühren ab dem ersten Semester und gegen Studiengebühren für sog. Langzeitstudierende ausgesprochen. Sie hat den damaligen Beschluss der KultusministerInnenkonferenz, das gebührenfreie Erststudium bis zum Diplom, Magister oder Master zu sichern, als Teilerfolg begrüßt. Weiter heißt es in dem Beschluss:
„Die BAG sieht die Herausforderung, eine bessere Ressourcensteuerung im Hochschulwesen zu erreichen und zu diesem Zweck Anreize zu schaffen, ein inhaltlich breit angelegtes und gleichzeitig strukturiertes Studium zu ermöglichen. (…) Die BAG sieht außerdem, dass im Zuge der Entwicklung zum lebensbegleitenden Lernen die Grenzen zwischen der Erstausbildung und dem zunehmend gebührenpflichtigen Weiterbildungsbereich stärker fließend werden.
Das Studienkontenmodell nimmt für sich in Anspruch, zu beiden Aspekten einen sinnvollen Beitrag zu liefern. Gegenüber diesem Modell gibt es in der BAG ernste Bedenken, die insbesondere
• Fragen der Kontingentierung und Ökonomisierung von Bildung generell,
• die Gefahr der inhaltlichen Verengung des Studiums und
• den mit dem Modell verbundenen Verwaltungsaufwand
betreffen.“
Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat 2001 erstmals ein Bildungsgutscheinmodell in die Debatte gebracht und ähnliche Beschlüsse 2003 und Anfang diesen Jahres wiederholt. Die Bundespartei mochte diese Position zu Studienkonten so nicht eilen und erwähnt sie im Wahlprogramm 2002 explizit nicht. Gleichzeitig hat die Bundespartei sowohl in ihrem Grundsatzprogramm als auch im Wahlprogramm 2002 ihre bisherige Position zu Studiengebühren bestätigt. Im Wahlprogramm 2002-2004 heißt es auf Seite 53: „Wir wollen nicht, dass durch Studiengebühren eine soziale Selektionswirkung eintritt. Dies lehnen wir ab. Insbesondere das Studium bis zum ersten Abschluss muss gebührenfrei bleiben.“
Der Bundestag hat mit der 6. Novelle des Hochschulrahmengesetzes (25.04.2002) Studiengebühren für das Erststudium im Grundsatz verboten, er hat dabei jedoch Gestaltungsspielräume für die Bundesländer eröffnet, nach denen die Erhebung von Langzeit- oder Zweitstudiengebühren sowie die Einführung von Studienkonten möglich sind. Daraufhin wurden auf Landesebene unterschiedliche Konten-, bzw. Gutscheinmodelle diskutiert (z.B. Rheinland-Pfalz, Berlin) und auch eingeführt (z.B. NRW). In vielen Bundesländern werden Gebühren für sog. Langzeitstudierende erhoben.
Gegen diese HRG-Novelle ist seit Mai 2003 eine Normenkontrollklage der sechs CDU-geführten Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt) beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Begründet wird die Klage damit, dass der Bund zu weit in die Bildungshoheit der Länder eingreife (z.B. mit dem Verbot allgemeiner Studiengebühren, aber auch mit Regelungen zur Verfassten Studierendenschaft). Mit einer Entscheidung wird in den kommenden Monaten gerechnet.
Ausgelöst vor allem durch die zunehmenden Finanzprobleme der öffentlichen Haushalte werden in den letzten Monaten immer mehr Stimmen laut, die die Einführung von allgemeinen Studiengebühren fordern oder befürworten. Dabei wird auch mit Ungerechtigkeiten zwischen dem weitgehend gebührenfreien Studium und anderen, kostenpflichtigen Bildungs- und Betreuungsangeboten argumentiert, und zwar an so unterschiedlichen Beispielen wie Kita-Plätzen oder privaten Berufsfachschulen.
Auch die seit Anfang dieses Jahres geführte Elite- und Innovationsdebatte hat nicht zu einer fundierteren Diskussion über die Studien- und Hochschulfinanzierung geführt. Manche AkteurInnen werben für die direkte Übertragung angloamerikanischer Modelle und verschweigen dabei die gleichzeitig notwendigen Stipendienmodelle, die Sozialquoten bei der Besetzung von Studienplätzen oder die im angloamerikanischen System viel größere Bedeutung privaten Mäzenatentums. Interessenvertreter von CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) bis BDI, die seit langem die Einführung von allgemeinen Studiengebühren fordern, erwecken zunehmend öffentlich den Eindruck, als seien Studiengebühren die wichtigste Innovation im Bildungswesen, mit der die meisten Probleme gelöst würden. Die größten Herausforderungen an das Bildungs- und Wissenschaftssystem, etwa die europäische und internationale Dimension, und die großen Strukturprobleme der Hochschulen, wie unzureichende Autonomie, schlechte Studienbedingungen, altmodische Lehr- und Lernformen, falsche Personalstrukturen und wenig attraktive Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs, werden dagegen kaum thematisiert.
Die BAG möchte in dieser Situation Anstöße für eine zukünftige Form der Bildungs- und Hochschulfinanzierung geben, die nicht nur finanz-, sondern auch bildungs- und gesellschaftspolitisch fundiert ist und die sowohl von der Bundesebene als auch von den Landesverbänden getragen werden kann.
II. Strukturelle Herausforderungen für die Hochschulen
Die Debatte um das Für und Wider von Studiengebühren wirkt, schaut man sich die Strukturen und Studienbedingungen der Hochschulen genauer an, wie eine Stellvertreterdebatte, um sich dem eigentlichen Reformbedarf nicht stellen zu müssen.
Gerade weil Studierende Ende letzten Jahres mit wochenlangen Protesten auf die schlechten Studienbedingungen aufmerksam gemacht haben, wäre es ein Hohn, wenn die notwendigen Reformen erneut nicht angegangen würden, aber den Studierenden einseitig ein finanzieller Beitrag abverlangt würde.
Die BAG hat in vielen ihrer Positionspapiere immer wieder Lösungsvorschläge für viele der strukturellen Fragen gemacht und so verdeutlicht, wo Innovationspotentiale im Hochschul- und Wissenschaftssystem liegen. Alle Probleme und Lösungsansätze hier zu skizzieren, würde den Rahmen dieses Papiers sprengen. Die schlechten Studienbedingungen stehen sicher im Vordergrund der Debatte und beginnen bei so simplen Problemen wie einem Sitzplatz im Seminar oder ausreichend Büchern in der Bibliothek, über ausreichend viele Tutorien und Praktikumsplätze, bis hin zur notwendigen deutlichen Qualitätsverbesserung der Lehre. Dringend verbessert werden müssen auch die Studienorganisation und insbesondere die Betreuung der Studierenden. Hinzu kommt durch die Unterfinanzierung und Kürzungen der Hochschuletats, vor allem in den Ländern, eine unzureichende Personalausstattung, die die Arbeitsbedingungen insbesondere des wissenschaftlichen Nachwuchses, trotz der guten Ansätze in der 5. HRG-Novelle, eher verschlechtert. Auch die wenig adäquaten Regelungen des öffentlichen Dienst- und Tarifrechts tragen zu diesen Problemen bei. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, den von vielen Seiten geforderten Wissenschaftstarifvertrag endlich in die Tat umzusetzen.
In einigen Ländern wird die Autonomie der Hochschulen positiv vorangetrieben, oft aber ohne eine ausreichende Evaluation und ohne die dazu notwendigen Strukturen – Stichwort ‚Demokratisierung und politische Kontrolle’ – ausreichend in die Hochschulen hineinzutragen.
In den Fällen, wo es gelingt, zwischen Hochschule und Land die Balance zwischen politischer Prioritätensetzung und eigenverantwortlicher Institution zu finden, wird dies nur zu oft durch finanzpolitische Zwänge ad absurdum geführt: Ein Globalhaushalt, der global gekürzt wird und mehrjährige Hochschulpakte, die doch nur bis zur nächsten Wahl halten, sind die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für Hochschulen, um sich im Wettbewerb zu positionieren und eigenständig langfristige Schwerpunktsetzungen zu betreiben. Damit wird auch die Instrumente leistungsbezogene Mittelvergabe und Zielvereinbarungen drastisch entwertet, ob wohl gerade diese grundsätzlich gut geeignet sehr, um auch ohne direkte steuernde Eingriffe in die Hochschulen Anreize zu wesentlichen Verbesserungen auch in Bereichen wie Frauenförderung, Internationalisierung oder Betreuung und Beratung von Studierenden zu geben.
Große Herausforderungen für die Hochschulen bringen auch die internationalen Entwicklungen mit sich: Die internationale Mobilität der Studierenden steigt, auch an die deutschen Hochschulen kommen wieder mehr Studierende aus dem Ausland. Hier fehlt es nicht mehr an internationalem Marketing, aber an umfassenden Betreuungsprogrammen und an entsprechenden arbeits- und ausländerrechtlichen Regelungen.
Die Studienstrukturen in der Bundesrepublik befinden sich derzeit in einem radikalen Umbruch. Mit der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge, die im Rahmen des Bologna-Prozesses erfolgt, wird auch eine inhaltliche und didaktische Studienreform dringend, die in der Lage ist, den neuen, gestuften Abschlüssen Qualität zu verleihen und den Bachelor nicht zum reinen Schmalspurstudium degradiert. Neue Lern- und Lehrformen, intensivere Betreuung und eine stärkere Orientierung auf Methoden- statt Faktenwissen, auf anschlussfähige Inhalte statt verengtes Spezialwissen sind notwendige Bestandteile dieser Studienreform. Im Bereich des Masterstudiums wird es mehr Angebote als die heutigen Diplomstudiengänge geben und es muss Polyvalenz gelten, d.h. BachelorabsolventInnen müssen die Wahl zwischen unterschiedlichen Masterangeboten haben.
Um diese notwendigen Veränderungen, wie auf europäischer Ebene verabredet, bis zum Jahr 2010 unter Beteiligung von Studierenden, Lehrenden und weiteren gesellschaftlichen Akteuren mit im europäischen Vergleich attraktiven Angeboten umzusetzen, muss eine Innovationsdebatte im deutschen Bildungssystem ausgerufen werden.
Zum Umfeld der bildungspolitischen Debatte gehört auch der Aspekt der Generationengerechtigkeit: Die Generation, die heute an den Hochschulen studiert, wird nicht nur einen ungleich größeren Teil ihres künftigen Einkommens auf die Eigenvorsorge im Gesundheits- und Sozialbereich verwenden müssen, sondern wird gleichzeitig wesentlich höhere Aufwendungen für die Versorgung der Ruhestandsgenerationen zu tragen haben. Die derzeitigen Debatten um die Renten- und Gesundheitsreform sind nur ein Vorgeschmack darauf. Es ist die Frage, ob es gerecht oder auch nur fair wäre, den jüngeren Generationen angesichts dieser mittelfristig steigenden Abgabenlasten auch noch einen höherer Beitrag für die eigene Ausbildung abzuverlangen, oder ob es im Sinne der Generationengerechtigkeit nicht angeraten wäre, dafür etwa über die Erbschaftssteuer den Reichtum der älteren Generationen heranzuziehen.
III. Elemente einer neuen Studien- und Hochschulfinanzierung
Bei Bündnis 90/Die Grünen werden derzeit in Zusammenhang mit der Bildungs- und Hochschulfinanzierung folgende Aspekte diskutiert:
1. Einführung einer elternunabhängigen Studienfinanzierung statt BaföG, etwa analog des BAFF;
2. stärkere Beteiligung von AkademikerInnen an der Finanzierung ihrer Ausbildung möglicherweise nachgelagerte Eigenbeteiligung;
3. verbesserte finanzielle Ausstattung der Hochschulen;
4. Stärkung des Elements der Nachfrageorientierung bei der Finanzierung der Hochschulen (durch Kontenmodelle oder andere Instrumente) mit dem Ziel, mehr Effizienz und mehr Qualität der Ausbildung zu erreichen.
Alle diese Aspekte werden in der öffentlichen Debatte oft vermischt, hängen aber nicht sehr eng miteinander zusammen: Zum Beispiel wird von einer nachgelagerten Eigenbeteiligung der Studierenden – wegen des großen Abstands von mehreren Jahren – kaum ein nachfragebezogener Impuls zur Verbesserung der Hochschulsteuerung oder der Qualität der Ausbildung ausgehen. Aus der Forderung nach einer nachfrageorientierteren Steuerung der Hochschulen wiederum kann nicht abgeleitet werden, dass sich Studierende stärker als bisher an der Finanzierung der Hochschulen beteiligen müssen.
Oft werden in der Debatte über die Studien- und Hochschulfinanzierung Modelle gegeneinander kontrovers diskutiert, die in Wirklichkeit ganz unterschiedlichen Zielen dienen. In den folgenden Abschnitten sollen deshalb die einzelnen Aspekte detailliert behandelt werden.
1. BAFF statt BAföG
An die Stelle des heutigen BAföG möchten wir nach vor ein mit mehr Eigenverantwortung und Elternunabhängigkeit verbundenes Modell der Finanzierung des studentischen Lebensunterhalts setzen. Grundlage dafür ist der Bundesausbildungsförderungsfonds (BAFF), wie er seit Mitte der 1990er Jahre von Bündnis 90/Die Grünen vorgeschlagen wird. Als Bundesarbeitsgemeinschaft der Grünen stehen wir weiterhin zum BAFF. Relevante Kernpunkte sind für uns das damit verbundene Bild eigenverantwortlicher und nicht an elterliche Entscheidungen gebundener erwachsener Studierender, eine nach eigener Einschätzung flexibel wählbare Unterstützung ohne bürokratischen Aufwand und das solidarische und an die Höhe sowohl des späteren Einkommens wie auch der aus dem BAFF in Anspruch genommenen Mittel gekoppelte Refinanzierungsmodell. Im Gegensatz zum heutigen BAföG ist BAFF damit an die vielfältigen Lebensrealitäten von Studierenden angepasst, nimmt diese ernst, ist in Bezug auf die Rückzahlungsmodalitäten intelligenter konzipiert.
Doch wir wollen nicht verschweigen, dass sich angesichts der Neuordnung des Familienlastausgleichs und durch die Steuerreformen die Finanzierungsgrundlagen für BAFF teilweise verändert haben. Deshalb bitten wir die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, zu prüfen, inwieweit bei einer Einführung von BAFF heute Anpassungen notwendig wären, und wie der Anschubfinanzierungsbedarf für einen Systemwechsel aussieht. Zu prüfen ist außerdem, wie sich das BAFF-Modell mit den Anforderungen und der Finanzierung lebenslangen Lernens – etwa durch nicht-konsekutive Master-Studiengänge – vereinbaren lässt.
Ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Hochschulfinanzierungsdebatte ist die mit dem BAFF verbundene nicht unwesentliche Eigenfinanzierungskomponente. Durch die einkommensabhängigen Beiträge zahlen AbsolventInnen im BAFF-Modell einen erheblich höheren Anteil ihrer vom BAFF vorfinanzierten Lebensunterhaltskosten wieder an den Fonds zurück, als dies heute beim BAföG der Fall ist, das zu 50% als Zuschuss gezahlt wird. Die schon hier höhere Eigenbeteiligung der Studierenden muss bei jeder Debatte über Studiengebühren berücksichtigt werden.
2. (Nachgelagerte) Eigenbeteiligung von Studierenden als neue Geldquelle für die Hochschulen?
Zahlreiche politische AkteurInnen erheben derzeit Forderungen nach einer Eigenbeteiligung der Studierenden an den Kosten ihrer Ausbildung (Studiengebühren). Doch die meisten Argumente halten einer genaueren Prüfung nicht stand.
Nicht immer sind die Motive so durchschaubar wie bei einigen Ministerpräsidenten und HaushaltspolitikerInnen der Länder, die gleichzeitig Studiengebühren fordern, während sie den Hochschulen neue Kürzungs- und Sparprogramme auferlegen, wie etwa derzeit in Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen oder Sachsen.
Von seriöserer Seite werden Studiengebühren meist nur unter der Bedingung gefordert – und gelegentlich auch von manchen Studierenden begrüßt –, dass diese Mittel den Hochschulen zusätzlich zur Verfügung stehen. Damit wird die Hoffnung verbunden, die teilweise desolaten Studienbedingungen an den Hochschulen durch Eigenbeiträge der Studierenden zu verbessern. In der derzeitigen Situation der öffentlichen Haushalte, die sich in den nächsten Jahren wohl kaum deutlich verbessern wird, ist jedoch nicht vorstellbar, dass die so eingenommenen zusätzlichen Mittel den Hochschulen nicht an anderer Stelle wieder gekürzt würden. Die Erfahrung lehrt eher das Gegenteil: Dort wo Studiengebühren bereits eingeführt wurden, kommen sie oft ganz oder zum Teil dem allgemeinen Staatshaushalt und nicht den Hochschulen zu Gute. Viele der sogenannten Solidar- oder Zukunftspakte, die seit Mitte der 1990er Jahre in vielen Bundesländern den Hochschulen unter Sparbedingungen zumindest eine mehrjährige Planungssicherheit garantieren sollten, wurden von den Landesregierungen immer wieder gebrochen oder vorzeitig aufgekündigt.
Sollte das Bundesverfassungsgericht im Laufe des Jahres mit seiner Entscheidung zum Hochschulrahmengesetz weitere Spielräume zur Einführung von Studiengebühren eröffnen, ist zu befürchten, dass einige Länder aus rein haushaltspolitischen Erwägungen Initiativen ergreifen, um diese so weit wie möglich, gegebenenfalls bis hin zur Einführung allgemeiner Studiengebühren, auszuschöpfen. Viele dieser Einnahmen werden den Hochschulen nicht zu Gute kommen.
Eine weitere erwartbare Folge eines solchen haushaltspolitisch motivierten Handelns wäre eine verstärkte Abwanderung von Studierenden und Studierwilligen in Bundesländer, die keine oder nur geringe Gebühren erheben, mit dem Erfolg, dass dort die Studiensituation erst recht verschlimmert wird und ein vermeintlicher Zwang zur Erhebung von Gebühren zu reinen Abwehrzwecken erzeugt wird. Das Ergebnis wäre eine unverändert schlechte Studiensituation an den Hochschulen, für die nun aber zusätzlich Gebühren erhoben würden – mit allen negativen Begleiteffekten einer Gebührenerhebung. Wir betonen nachdrücklich die Notwendigkeit der Einführung einer bundeseinheitlichen Rahmenregelung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse.
Direkte Studiengebühren werden von den meisten AkteurInnen in der Debatte wegen ihres Abschreckungseffektes auf StudienbewerberInnen vor allem aus sozial benachteiligten Familien abgelehnt. Es ist aber offen, ob nicht auch nachgelagerte Studiengebühren als eine Art „Schuldenberg“ wirken und damit zumindest einen psychologischen Abschreckungseffekt mit sich bringen. Erste Erfahrungen aus Staaten, in denen nachgelagerte Gebührenmodelle eingeführt wurden, wie zum Beispiel Australien mit dem Higher Education Contribution Scheme (HECS), legen solche Schlussfolgerungen nahe. Eine erhebliche Belastung der Berufseinstiegs- und Familiengründungsphase mit Schulden aus der Finanzierung eines Studiums hat darüber hinaus weitere, auch volkswirtschaftlich negative Effekte, wie die Erfahrungen mit der Verschuldungslast der Privathaushalte z.B. in den USA zeigen. Außerdem haben nachgelagerte Studiengebühren den finanzpolitischen Nachteil, dass entweder Einnahmen erst nach einigen Jahren erzielt werden, oder – bei per Kredit zwischenfinanzierten Modellen – der Staat Ausfall- und Zinskosten übernehmen müsste.
Vielfach werden Studiengebühren mit dem Argument gefordert, AkademikerInnen würden im späteren Leben Einkommensvorteile gegenüber nicht akademisch ausgebildeten Personen erzielen, also eine deutlich höhere Bildungsrendite erzielen: Der früh ins Berufsleben hineingewachsene Handwerksgeselle subventioniere mit seinen Steuern die Ausbildung der künftigen Ärztin, obwohl er weniger Lebenseinkommen als sie erzielt. Sinnvoller ist jedoch der Vergleich der Kinder von beiden. Wird die Hochschulbildung über Steuern finanziert, dann zahlt die Ärztin eben mehr für die Ausbildung ihrer Kinder als der Handwerker, läuft die Finanzierung über Gebühren, dann zahlen sie beide gleich. Gebühren sind nicht progressiv, im Gegensatz zur Besteuerung von Einkommen.
Diese Bildungsrendite zu quantifizieren, stößt jedoch an die Grenzen volkswirtschaftlicher Methodik. Ihre Höhe ist unter ÖkonomInnen umstritten. Fest steht jedoch: In Deutschland liegen die privaten Renditen des Hochschulstudiums weit unter den Renditen in Ländern mit Studiengebühren und auch noch unter dem OECD-Durchschnitt. Dort ist also die Schieflage zwischen AkademikerInnen und NichtakademikerInnen viel stärker, bei einem gleichzeitig zum Teil erheblich höheren AkademikerInnanteil an der Gesamtbevölkerung.
Weiter muss berücksichtigt werden, dass die Ausbildung von AkademikerInnen auch eine gesellschaftliche Rendite mit sich bringt, da immer mehr gesellschaftliche Probleme zu Gunsten aller mit wissenschaftlichen Methoden gelöst werden müssen. Diese gesellschaftliche Rendite ist erst recht kaum zu messen.
Noch schwieriger als die Analyse der Bildungsrenditen heute ist die Prognose, welche Bildungsrenditen die Generation der Studierenden, die heute oder morgen an den Hochschulen studiert, erzielen wird. Mit einer Erhöhung der AkademikerInnenquote auf mindestens die Hälfte eines Jahrganges und mit der zunehmenden Akademisierung von Ausbildungsberufen ist zu vermuten, dass sich diese Renditen auf einem niedrigeren Niveau einpendeln werden, als es die Generation erzielen konnte, die Mitte der 1970er Jahre die Hochschulen verlassen hat.
Alle Studien über Bildungsrenditen ermitteln im Übrigen nicht individuelle, sondern nur durchschnittliche Renditen, und diese sind zudem von Studienfach zu Studienfach unterschiedlich. Philosophiestudierende und Studierende der Diplompädagogik erzielen beispielsweise im Durchschnitt eine negative Rendite aus ihrem Studium, ihnen müsste demnach vom Studium abgeraten oder, wenn sie es doch beginnen, ein Renditeausgleich (eine Art „Gefahrenzulage“) aus öffentlichen Mitteln gezahlt werden.
Angesichts fehlender wissenschaftlicher Evidenz bei der Verteilungswirkung, aufwändiger individueller Gestaltung der Abgabe und im internationalen Vergleich geringer Bildungsrenditen stellt sich die Frage, ob nicht eine Abschöpfung der „Bildungsrendite“ wie bisher aus der allgemeinen, progressiven Einkommenssteuer die gerechtere und effizientere Variante ist.
Zusammengefasst heißt dies: Eine Notwendigkeit zur Einführung von Studiengebühren lässt sich nicht aus irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten. Die Entscheidung, wie hoch ein Hochschulstudium oder auch andere Bildungskarrieren mit individuellen Abgaben oder Steuern belastet werden soll, bleibt eine politische Entscheidung.
Ein abgewandeltes Verteilungsargument, das gerade in der grünen Diskussion oft vorgebracht wird, besteht in dem Vergleich des weitgehend gebührenfreien Hochschulstudiums mit den kostenpflichtigen Kita-Plätzen. Ein solches gegeneinander Ausspielen der Interessen von Eltern von Kleinkindern und Studierenden (und deren Eltern als einer der wichtigsten Finanzierungsquelle für junge Erwachsene) lenkt dabei von einem zentralen Punkt der Kritik am bundesdeutschen Bildungssystem ab: Es geht nicht darum, einen Bereich auf Kosten anderer zu stärken, das gesamte Bildungssystem bedarf einer kritischen Betrachtung und ‚Generalüberholung’ in vielen Punkten. Dazu gehört auch eine Neubetrachtung der Ausgaben für Bildung und Bildungseinrichtungen als Investitionen in die zukünftigen Generationen. Die zu Recht stark kritisierte sozial selektiven Tendenzen des bundesdeutschen Bildungssystems und die lange vernachlässigte Anerkennung des vorschulischen Bereiches als wichtigem Bildungsbereich können nicht glaubhaft als Ausrede dafür benutzt werden, nun die Bedingungen am anderen Ende, im Bereich der Oberschulen und Hochschulen, zu verschlechtern.
Es liegt aus Sicht der BAG auf der Hand, dass eine stärkere Eigenbeteiligung der Studierenden an den Ausgaben für die Hochschulen, auch wenn sie nachgelagert wäre, zwar dem Staat eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnen, aber das drängende Ziel, die Lage der Hochschulen in Deutschland zu verbessern, nicht erreichen würde. Sie aus einer vermeintlichen Gerechtigkeitsargumentation heraus zu fordern, führt zu Widersprüchen. Die in der öffentlichen Diskussion unterstellte Verteilungswirkung staatlicher Hochschulfinanzierung ist wissenschaftlich nicht hinreichend abgesichert. Die Studiengebührendebatte führt dabei dazu, dass die einzelnen Bildungsbereiche gegeneinander ausgespielt werden, statt dass das Bildungsproblem in Deutschland tatsächlich angegangen wird.
Die BAG hält daher am Grundsatz der Gebührenfreiheit des Erststudiums bis zum heute üblichen Niveau Diplom, Magister oder Master fest (Die Promotionsphase wird von der BAG nicht als letzte Phase des Studiums, sondern als erste Phase der wissenschaftlichen Karriere angesehen und kann daher ebenfalls nicht mit Gebühren belegt werden.) und lehnt die Einführung sowohl von direkten als auch von nachgelagerten allgemeinen Studiengebühren ab.
3. Gesellschaftlicher Impuls für Bildung statt isolierter Konzepte
Das eigentliche Problem der Hochschulfinanzierung liegt tiefer und wird von der lautstarken Debatte über Gebühren nur verdeckt: Gemessen an seiner Wirtschaftsleistung liegt Deutschland im weltweiten Vergleich bei der Finanzierung seiner Hochschulen weit hinten. 1999 etwa wurden nur 1,06% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Hochschulen aufgewendet, davon 0,97% aus staatlichen und die restlichen 0,09% aus privaten Mitteln. Gemessen am BIP investieren europäische Länder wie Frankreich, die Schweiz oder die Niederlande, aber selbst die USA mehr staatliche Mittel in die Hochschulen. Und auch die privaten Mittel liegen in den meisten Ländern deutlich höher. Zu den privaten Mitteln zählen übrigens nur im geringen Maße Eigenbeträge der Studierenden, sondern vor allem Mittel aus Stiftungen, Unternehmen und anderen gesellschaftlichen Gruppen.
Eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation der deutschen Hochschulen, Schulen und anderer Bildungsbereiche kann aus Sicht der BAG deshalb nur von einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller gesellschaftlichen Gruppen erwartet werden. Dazu müssen auch mehr staatliche Mittel mobilisiert werden. Statt den derzeit laufenden Steuersenkungswettbewerb immer weiter fortzuführen, der zu weiteren Kürzungen in allen Bildungsbereichen führen wird, sollten Hochschulen, aber auch Schulen und Kitas endlich als ein Innovationsfeld erkannt werden, in das es sich zu investieren lohnt. Mögliche Finanzierungsquellen wären:
• ein „Bildungscent“, den alle SteuerbürgerInnen zweckgebunden, orientiert an der üblichen Steuerprogression, leisten.
• Mit der anstehenden Reform könnte die Erbschaftssteuer nicht nur aufkommensneutral umgestaltet, sondern als sozial gerechtes Instrument genutzt werden, um mehr staatliche Mittel für Bildung zu mobilisieren.
• Die von vielerlei Seite geforderte Nutzung von Einnahmen aus dem Verkauf der Goldreserven der Bundesbank für Bildung sollte in die Tat umgesetzt werden.
• Durch einen Abbau ökologisch schädlicher Subventionen können weitere Mittel freigesetzt werden.
Wirkungsvoll kann eine verbesserte Finanzierung nur sein, wenn sie auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens beruht und nicht kurzfristigen haushaltspolitischen Zwängen zum Opfer fällt. Auch muss sie von Bund und Ländern gemeinsam getragen werden. Die Arbeitsteilung zwischen Bund und Ländern muss diesem gemeinsamen Ziel dienen. Gegenseitige Blockaden müssen vermieden werden. Sonderprogramme und Alleingänge von Seiten des Bundes, wie etwa das von Bundesbildungsministerin Bulmahn angekündigte 250-Millionen-Euro-Programm für Spitzenhochschulen, haben keinen längerfristig fördernden Effekt.
Die Erfahrungen mit den in vielen Bundesländern eingeführten und wieder gebrochenen Hochschulverträgen und -pakten lassen insbesondere Ansätze diskussionswürdig erscheinen, die verbesserte Finanzierung des Bildungssystems unabhängig von den Unwägbarkeiten der öffentlichen Haushalte zu sichern und einen Teil der Mittel einem von der Wissenschaft selbst verwalteten, wettbewerblichen System zu übergeben, so wie mit der Idee einer „Stiftung Bildung“ angedacht. Zusätzlich sollte eine Kultur gefördert werden, in der Stiftungs- und Mäzenatentum Bildung in verstärktem Maße mit privaten Mitteln fördert.
4. Nachfrageorientierte Finanzierung der Hochschulen durch Kontenmodelle
Bei sogenannten Studienguthaben-, Gutschein-, Credit- oder Studienkontenmodellen (kurz: Kontenmodellen) erhalten Studierende ein geldwertes Studienguthaben mit begrenztem Umfang, von dem sie pro Semester oder pro besuchter Lehrveranstaltung jeweils einen Teil an die Hochschule abgeben und so zu deren Finanzierung beitragen. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass Studierende in ihrer Rolle als Nachfragende gestärkt werden und so bessere Studienbedingungen und eine bessere Lehrqualität von den Hochschulen einfordern können.
Viele Studierende, aber auch andere politische AkteurInnen stehen solchen Modellen kritisch gegenüber. Die jüngsten Studierendenproteste nahmen in ihren Resolutionen kritisch dagegen Stellung. Das ist verständlich, denn sie sind bisher allesamt mit einseitigen Restriktionen für die Studierenden verbunden:
• Bereits die in Baden-Württemberg Mitte der 1990er Jahre eingeführten Gebühren für sog. „Langzeitstudierende“ wurden als ein Guthaben deklariert, das bis zur Regelstudienzeit plus vier Semester reicht. Wer länger studiert, muss seitdem automatisch Gebühren zahlen.
• Die bis 2007 gültige erste Stufe des Studienkontenmodells in NRW begrenzt die Nutzung des Guthabens grundsätzlich auf die 1,5-fache Regelstudienzeit. Das derzeit in der Einführung befindliche Studienkontenmodell in Rheinland-Pfalz soll darüber hinaus Studierende begünstigen, die nach der Regelstudienzeit plus ein Semester ihr Studium abschließen.
• Andere Kontenmodelle orientieren sich zwar nicht mehr an Studienzeiten, sehen aber ein geringeres Guthaben vor, als es für das heute übliche wissenschaftliche Studium bis zum Diplom, Magister, Staatsexamen oder Master nötig wäre.
Kontenmodelle mit einem zeitlich so eng begrenzten Studienguthaben können jedoch nur schwierig, etwa über Sozialklauseln, Rücksicht auf zahlreiche Lebensumstände nehmen, die ein Teilzeitstudium oder ein länger andauerndes Vollzeitstudium notwendig machen oder individuell sinnvoll erscheinen lassen. Sie sind auch deshalb wenig zukunftsträchtig, weil grundständige Bildung und Weiterbildung in Zeiten der zunehmenden Individualisierung von Bildungsbiographien und des lebensbegleitenden Lernens immer stärker ineinander übergehen werden.
In der generellen Einschätzung von Kontenmodellen gibt es in der BAG unterschiedliche Positionen.
Position 1:
Aus der Sicht einer knappen Mehrheit (14 zu 13 Stimmen für die Position 1 in der entsprechenden Abstimmung) der Delegierten sind Kontenmodelle abzulehnen. Nach dieser Position führen Kontenmodelle zu einem unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand und zu einer weitgehenden Ökonomisierung der Studiensituation. Auch wird das einseitige Druckausüben auf den oder die Studierende kritisiert, sowie die Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der Idee einer Nachfragemacht der Studierenden und einer Steuerung hierüber kritisch hinterfragt:
1. Die postulierte Nachfragemacht der Studierenden, Kernpunkt der Argumentation vieler StudienkontenbefürworterInnen, die mit der Einführung dieses Mittels vor allgemeine Verbesserung der Lehre und eine allgemeine Qualitätssteigerung verbinden, wird von den VertreterInnen dieser Position als äußerst gering und wenig Veränderungen bewirkend angesehen – insbesondere, wenn man sie mit den Potenzialen anderer Instrumente, wie einer Stärkung der leistungsbezogenen Mittelvergabe und einer Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten von Studierenden vergleicht. Die beabsichtigte Wirkung des Studienkontensystems, durch eine „Abstimmung mit den Füßen“ hin zu guten Lehrangeboten einen Anreiz zur Verbesserung von Lehre zu schaffen, lässt die realen Bedingungen, unter denen Studienplatzentscheidungen, Studienfachwahl und auch Lehrveranstaltungsbelegung geschehen, außer Acht. Dort, wo Mittelströme nicht an ganze Hochschulen, sondern wie in den stärker ausdifferenzierten und auch Credit Points basierenden Studienkontenmodellen vorgesehen, an Institute oder sogar Fachgebiete vergeben werden, hat der Nachfrageeffekt sogar eindeutig kontraproduktive Wirkungen: Belohnt werden die Massenvorlesungen, bestraft kleine arbeits- und betreuungsintensive Hauptseminare.
2. Dadurch, dass Bildung über Gutscheine als Ware dargestellt wird, und durch die damit verbundenen Leitbilder (Hochschule als Unternehmen mit KundInnen) kann es zu einem Prozess der Ökonomisierung der Hochschule kommen: eine gute Hochschule ist eine, die viele erfolgreiche, d.h. marktgängige AbsolventInnen produziert. In eine KundInnen-Rolle gedrängt, wird von Studierenden weder eine Beteiligung an der demokratischen Selbstverwaltung der Hochschule erwartet noch ein Interesse für nicht marktfähige Angebote; wichtig ist nur noch die erreichbare Rendite und deren Maximierung. Diese mit einer Ökonomisierung der Hochschulen verbundenen Denkweisen können mittelfristig dazu führen, dass nicht marktgängige – aber vielleicht wissenschaftlich oder gesellschaftlich wichtige – Angebote eingestellt werden, dass Abläufe in der Hochschule sich nur noch an ökonomisch operationalisierbaren Werten orientieren, und dass die Hochschulen und Studierenden ihr Selbstverständnis als Demokratie und als Teil des Wissenschaftssystem systematisch verlieren werden.
3. Aufgrund der im Unterschied etwa zu Konsumwaren äußerst geringen Elastizität der ‚Ware’ Bildung (Pflichtveranstaltungen, über N.C. oder Auswahlverfahren „errungene“ Studienplätze, die nicht aufgegeben werden, nicht direkt mit dem Studium verknüpfte Entscheidungskriterien wie Elternnähe oder -ferne oder gesellschaftliche Modetrends) lassen vermuten, dass die Effizienzgewinne durch eine Nachfragesteuerung weitaus geringer als erhofft ausfallen.
4. Bildungsgutscheine stellen Studiengebühren dar, für die allerdings befristet der Staat einspringt. Grundsätzlich ist mit der Einführung eines solchen Modells der Schritt zum gebührenpflichtigen Studium getan.
5. Durch die Notwendigkeit, ab einem bestimmten Zeitpunkt Guthaben (oder Verweilrecht an der Hochschule) nachzukaufen, sind Studienkonten nichts anderes als verdeckte Langzeitstudiengebühren – also Strafgebühren, die die einzelnen Studierenden für langes Verweilen an der Hochschule (bei semesterbezogenen Gebühren) oder für ein intensives Studium (bei Semesterwochenstunden- oder Credit-Point-Modellen) bestrafen. Neben der Tatsache, dass die übergroße Mehrheit von Studierenden de facto in Teilzeit studiert, und die Studienbedingungen vielerorten so sind, dass selbst bei großer Motivation und ohne den Zwang zum Gelderwerb ein Studium in der Regelstudienzeit kaum möglich ist, werden Studierende mit Langzeitstudiengebühren, die integraler Bestandteil aller Studienkontenmodelle sind, genau dann finanziell getroffen, wenn sie eigentlich gerade in der Abschlussphase ihres Studiums sind.
6. Nicht nur, wenn Bildungsgutscheine die wahren Kosten durch die einzelnen Studierenden abbilden sollen, bergen sie noch weitere Probleme: Die Verwaltung der Gutscheine wäre außerordentlich kompliziert und spätestens wenn der Zeitpunkt der Zuzahlung gekommen ist, auch extrem ungerecht (vgl. oben die Argumentation gegen allgemeine Studiengebühren). Ein hoher Verwaltungsaufwand ergibt sich vor allem dann, wenn Kontenmodelle zielgenau wirken sollen. Im Extremfall müsste jeder einzelne Veranstaltungsbesuch kontrolliert und verbucht werden. Dies ist nicht nur aus Datenschutzgründen fragwürdig. Auch die ohnehin große Tendenz, im Zuge der Umstellung auf Bachelor und Master Studiengänge wieder stärker zu verschulen, würde durch Anwesenheitskontrollen, Testatpflichten und ähnliche Begleiterscheinungen einer veranstaltungsgenauen, credit-point-scharfen Erfassung und Abrechnung des Studienguthabens weiter verstärkt.
7. Die beabsichtigte Lenkungswirkung von staatlichen Zuschüssen entsprechend der Auslastung oder ‚Nachfrage’ nach bestimmten Studienangeboten kann mit einer Hochschulsteuerung, in der die Grundfinanzierung nach der Zahl der Studierenden in bestimmten Fächerclustern gezahlt wird (Beispiel Hessen), mindestens genauso gut erreicht werden. Der erhebliche zusätzliche Verwaltungsaufwand, die zu etablierenden Sanktionsmechanismen, die Kontrollpflichten des Studienkontenmodells können bei einer solchen Variante entfallen.
8. Modelle, die auf der Idee eines ‚Marktes’ von Bildungsangeboten basieren, aus denen der oder die StudieninteressentIn das für sie oder ihn beste Angebot auswählt, werden durch die mittlerweile Jahrzehnten fortbestehende drastische Unterausstattung mit Studienplätzen völlig konterkariert. Es besteht real kein Überangebot von Studienplätzen, aus dem im Rahmen einer rationalen Entscheidung allein oder auch nur primär nach Qualitätsparametern durch die StudieninteressentInnen eine Auswahl getroffen werden könnte. Dies aber müsste gegeben sein, um zumindest Grundzüge eines Anreizes für die Hochschulen zu schaffen, Studierende durch gute Betreuung, Lehre, besondere Studienformen an sich zu binden. Derzeit müssen Hochschulen eher darum kämpfen, nicht durch ständig steigende Studienzahlen bei stagnierenden oder sinkenden Mitteln einen einmal erreichten Qualitätsstandard zu riskieren. Die Marktidee hinter dem Studienkontomodell kann also kaum funktionieren.
Position 2:
Eine knappe Minderheit (3 13 zu 14 Stimmen in der entsprechenden Abstimmung für Position 2 ) der Delegierten befürwortet Kontenmodelle grundsätzlich, wenn sie den Einfluss der Studierenden auf die Studienbedingungen und die Lehrqualität stärken und den Hochschulen finanzielle Anreize geben, beides zu verbessern. Wenn sie richtig ausgestaltet sind, ermöglichen diese Modelle es allen Studierenden, gebührenfrei zu studieren. Sie verhindern damit allgemeine Studiengebühren mit ihren sozial abschreckenden Wirkungen.
Um dies zu erreichen, müssen aus dieser Perspektive allerdings einige Bedingungen erfüllt sein:
1. Das Guthaben muss für das heute übliche wissenschaftliche Studium bis zum Diplom, Magister, Staatsexamen oder Master ausreichen und der Verbrauch des Guthabens darf zeitlich nicht zu eng begrenzt sein (vgl. Einleitung zu III.4). Um etwa ein Teilzeitstudium zu ermöglichen, muss für den Verbrauch des Guthabens die doppelte Regelstudienzeit zur Verfügung stehen. Beides stärkt die Studierenden als NachfragerInnen, statt ihnen neben der Begrenzung des Guthabens weitere Restriktionen aufzuerlegen. Außerdem wird so klar gestellt, dass Kontenmodelle die verbesserte Steuerung der Hochschulen durch Nachfrageeffekte zum Ziel haben und nicht die Erschließung neuer Einnahmequellen.
2. Das Guthaben sollte statt in Zeiteinheiten (z.B. Semestern) in Credits bemessen werden. Dies ermöglicht unterschiedliche Intensitäten des Studiums abhängig von der jeweiligen Lebenssituation. Es ist auch angesichts der bereits laufenden Umstellung aller Studiengänge auf Credits im Rahmen des europäischen Bologna-Prozesses konsequent.
3. Ein fachlich breites und interdisziplinäres Studium darf nicht behindert werden. Nur der Besuch von abschlussrelevanten Lehrveranstaltungen darf zum Verbrauch von Studienguthaben führen, nicht aber der Besuch von Wahlveranstaltungen, Seminaren aus anderen Fächern, die Gestaltung von Projekten u.ä. Dies verringert auch den Verwaltungsaufwand.
4. Studierende müssen bei schlechter Qualität des Lehrangebots die Möglichkeit haben, ihr Studienguthaben zurückzufordern, etwa durch ein „Rücktrittsrecht“ nach den ersten Veranstaltungswochen.
5. Der Verbrauch von Studienguthaben muss Einfluss auf die Verteilung der öffentlichen Mittel zwischen und innerhalb der Hochschulen haben – von ihm muss ein Anreiz zur Verbesserung der Lehrqualität ausgehen. Zugleich darf die nachfrageorientierte Finanzierung nur einen Teil der Finanzausstattung der Hochschulen bzw. Fächer umfassen: Die Existenz eines Faches bzw. einer Hochschule darf nicht durch Einbrüche in der Studierendennachfrage, wie sie z.B. auf Grund kurzfristiger Entwicklungen am Arbeitsmarkt vorkommen bedroht werden.
6. Kontenmodelle sollten einen länderübergreifenden Effekt haben: Bundesländer, die überproportional viele Studienplätze anbieten, sollten Vorteile gegenüber Bundesländern haben, die eine unterproportional große Anzahl an Studienplätzen anbieten.
7. Der Wechsel des Studienplatzes zwischen Hochschulen innerhalb Deutschlands und Europas darf nicht behindert werden.
8. Kontenmodelle sollten langfristig anschlussfähig an andere Bildungsbereiche wie Schule, berufliche Bildung oder Weiterbildung sein.
Ein Modell, das diesen Anforderungen in wesentlichen Teilen entspricht, ist die ab dem Jahr 2007 geltende zweite Ausbaustufe des Studienkontenmodells in NRW.
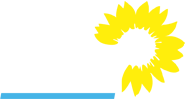
Verwandte Artikel
Beschluss: „Faire Arbeitsverträge in der Wissenschaft!“
Seit 2007 regelt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) die befristete Anstellung von Wissenschaftler*innen. Als Sonderarbeitsrecht ermöglicht es prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Schon die Novelle im Jahr 2016 hatte das Ziel, den…
Weiterlesen »
#WeStandWithUkraine
Nur Frieden und Demokratie ermöglichen Freiheit – auch Wissenschaftsfreiheit in gesellschaftlicher Verantwortung.
Weiterlesen »
Rahmenstruktur der Beschäftigung in der Wissenschaft
Beschäftigung in und mit Wissenschaft ist geprägt durch ein besonderes Arbeitsumfeld. Das liegt begründet einerseits in der großen Freiheit bei der Wahl der Ziele, Zwecke und Mittel der Tätigkeit, die…
Weiterlesen »